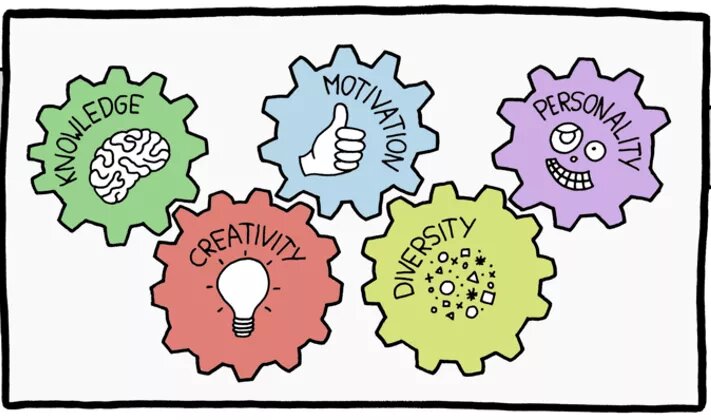
von Carsten Herrmann-Pillath
Diversity: Wert an sich oder bewertbare Ressource?
Für viele LeserInnen mag die hier aufgeworfene Frage fast schon ethisch ehrenrührig sein. Diversity betrifft Grundwerte der Menschenwürde und des respektvollen Umgangs miteinander – wie kann es, wie sollte es sich ‚auszahlen’? Fast möge man meinen: Selbst wenn es sich nicht auszahlt, bleibt es ein kategorischer Imperativ. In der Tat, wir treffen hier auf ein Paradox: Wer diese Frage stellt, muß letzten Endes auf Standards Bezug nehmen, die womöglich außerhalb des Wertekanons der Diversity stehen: Das stellt dann aber den Wert der Diversity selbst in Frage. Andererseits: muss Diversity nicht auch die Diversity von Werthaltungen und Meinungen zu Diversity respektieren?
Ich möchte im Folgenden versuchen, dieses Paradox pragmatisch und praktisch zu entschärfen. Ich denke, die Frage nach dem Nutzen von Diversity macht Sinn, wenn wir klar zwischen Diversity und Diversity Management (DiM) unterscheiden. DiM bezieht sich auf den Umgang mit Diversity in Organisationen, und hier ist es vernünftig zu fragen, ob seine Ziele zu angemessenen Kosten erreicht werden. Gleichwohl läßt sich das Paradox nicht ganz heilen: Denn es bleibt offen, woher die Ziele kommen und vor allem, wer sie definiert.
Diese Frage ist besonders in betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen wichtig, um die es im Folgenden hauptsächlich gehen soll. Betriebswirtschaftliche Betrachtungsweisen gelten aber keineswegs nur für gewinnorientierte Organisationen, sondern auch für alle öffentlichen und non-profit-Organisationen. Selbst eine NGO, die sich mit Diversity ausschließlich befaßt, hat ein begrenztes Budget und muß sich nicht nur fragen, sondern oft auch rechtfertigen, ob und wie sie ihre Mittel zieladäquat einsetzt. In gewinnorientierten Organisationen bricht das Paradox aber mit aller Macht hervor: Wir wissen aus vielen empirischen Untersuchungen, dass Diversity an sich nicht unbedingt zur Leistungssteigerung von Organisationen führt (manchmal auch zum Gegenteil), weil Diversity Kosten verursacht (Konfliktkosten, Kommunikationskosten etc.). Konzepte wie dasjenige der ‚Unternehmenskultur’ sollen diese Effekte der Diversity gerade dadurch minimieren, indem Diversity durch Integration verringert wird: Gleichsam, die Unternehmenskultur als zielkonforme gemeinsame ‚Benutzeroberfläche’ von sozialen Interaktionen in der Organisation.
Wir wissen aber aus vielen empirischen Untersuchungen auch, dass Diversity durch ein geeignetes DiM leistungssteigend wirken kann. DiM wirkt, abhängig vom Kontext, nicht nur kostenreduzierend, sondern wirkt auch positiv auf die Zielerreichung von Organisationen.
Vom passiven zum aktiven DiM
Daraus könnte man zunächst schlußfolgern, dass es zwei grundsätzlich unterschiedliche Strategien gibt, mit Diversity unter dem Leistungsgesichtspunkt umzugehen: Die eine ist, DiM zu etablieren und Diversity zum Zuge kommen zu lassen, die andere besteht darin, gezielt nur dasjenige Ausmaß an Diversity im Rahmen der Personalplanung zuzulassen, das mit den Organisationszielen konform geht. Die zuletzt genannte Strategie muß keineswegs eine diskriminierende sein, sondern kann, wie eben gesagt, bedeuten, dass gezielt am Aufbau einer homogenisierenden Unternehmenskultur gearbeitet wird: DiM sozusagen unter umgekehrtem Vorzeichen, als gestaltete, diversitätsreduzierende Integration. Wie man sieht, überlappen sich die Themen im betriebswirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Bereich durchaus (Stichwort ‚Leitkultur’).
Nun ist gegenwärtig bekanntlich ein Treiber der Verbreitung des DiM die Einsicht, dass die einzelwirtschaftliche Gestaltungsfreiheit hinsichtlich der Diversity begrenzt ist. Die Vielfalt bricht sozusagen über die Unternehmen herein, als Ergebnis demographischer Entwicklungen, der Globalisierung und anderer Kräfte. Das ist gemeinhin der ‚business case’ für DiM. Dann müssen wir aber deutlich zwischen reaktivem und aktivem DiM unterscheiden:
- Das reaktive DiM erhebt Diversity nicht zu einem strategischem Faktor in der Unternehmung, und schon gar nicht zu einem Unternehmensziel unter anderen. Es konzentriert sich auf die Schadensbegrenzung, also die Vermeidung von Kosten der Diversity.
- Das aktive DiM kann wiederum zwei Positionen einnehmen:
- Es kann entweder Diversity als zu aktivierende Ressource betrachten und setzt DiM also auch im Sinne einer Steigerung und Potenzierung von Diversity ein, oder noch weitgehender,
- es kann die gesellschaftspolitische Dimension von Diversity selbst in die Ziele des Unternehmens aufnehmen, dem DiM also auch eine wesentliche Rolle im Konzept der Corporate Social Responsibility (CSR) zuschreiben. Das hat zur Folge, dass die Diversity in der Gesellschaft zu einer wichtigen Determinante der möglichen Stakeholder einer Organisation wird.
Grundsätzliche Grenzen der Meßbarkeit des Erfolgsbeitrages von DiM
Unabhängig davon, welche der drei Varianten zum Zuge kommt, gibt es aber ein grundsätzliches Problem der Messung von DiM-Effekten, das allerdings auch für andere Formen der Messung von Managementmaßnahmen und deren Ergebnis gilt: Die direkte Beziehung zwischen Maßnahmen und Erfolgsbeitrag ist oft schwer bestimmbar, und die wichtigsten Wirkungen bestehen in der Vermeidung von Kosten, die entstehen, wenn die Maßnahmen eben nicht ergriffen werden. Das sind nun nichts anderes als die schnöden Opportunitätskosten der Ökonomen: Ökonomisch zählt eigentlich nur das, was an Alternativen verloren geht, bei knappen Mitteln. Das ist aber niemals direkt in den Zahlen der Buchhaltung ablesbar: Die Kosten der Unterlassung von DiM sind die verlorenen Erträge des DiM, und diese werden erst transparent, wenn im marktwirtschaftlichen Wettbewerb ein Unternehmen ohne DiM von einem Unternehmen mit DiM überflügelt wird.
Diese Perspektive ist ungemein hilfreich, um das Problem der Messung und Qualitätskontrolle im DiM anzugehen. DiM-Maßnahmen sind typischerweise eher langfristig angelegt: Wer etwa ein Mentoring-Programm für Angestellte mit Migrationshintergrund auflegt, wird erstens, nur nach einigen Jahren überhaupt Wirkungen nachweisen können, und zweitens, es wird schwierig sein, den spezifischen Beitrag dieses Programms selbst zu messen, denn es können ja auch viele anderen Faktoren auf einen eventuell zunehmenden Anteil von Führungskräften mit Migrationshintergrund Einfluss nehmen.
Das bedeutet, es besteht grundsätzlich ein Spannungsverhältnis zwischen der Greifbarkeit der Kosten des DiM und der Diffusität seiner Erträge. Diffusität bedeutet hier keineswegs, dass die Erträge selbst in Zweifel gezogen werden: Sie sind nur schwer meßbar und zeitlich und sachlich schwer zurechenbar. Das Ergebnis ist aber häufig, vor allem in Zeiten des Kostendrucks, dass DiM unter Legitimationsdruck gerät: Die Verringerung der Ausgaben für DiM ist eben eine leicht anfaßbare Größe, und das Management kann sich Erfolge bei der finanziellen Stabilisierung zuschreiben. DiM steht mit dieser Problematik nicht alleine: Ähnliches gilt für viele Marketing-Maßnahmen, für die Personalentwicklung oder sogar für die Forschung im Unternehmen.
Lösungswege: Kombination quantitativer und qualitativer Methoden
Eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen, besteht darin, die Kosten zunächst nur auf die Ziele, nicht aber auf eine gemessene Zielerfüllung zu beziehen. Ein Diversity-Controlling- System würde also einen qualitativen und einen quantitativen Ansatz mischen. Die Ziele bleiben qualitativ definiert. Geprüft wird, ob die Kosten zieladäquat sind, aber nicht, in welchem Umfang sie zur Zielerfüllung beigetragen haben. Das ist durchaus informativ. Beispielsweise hat man in den USA teilweise die Erfahrung gemacht, dass eher kurze und sporadische Diversity-Trainings kontraproduktiv wirken können, weil das Problem zwar zu Bewußtsein gebracht wird, aber keine Lösungen angeboten werden. Das Training verschärft also nur die Wahrnehmung von Diskriminierung. Ohne Zweifel, selbst wenn hier keine Zahlen zur Zielerfüllung vorliegen, reichen solche Erkenntnisse zur Evaluierung der Methode aus. In diesen Fällen hieße die Devise: Besser kein DiM, als sporadische und fragmentierte Einzelmaßnahmen. Entweder richtig, oder gar nicht!
Eine andere Möglichkeit besteht darin, auf Kausalhypothesen zu verzichten, aber die Entwicklung der Inputgrößen und der Zielgrößen holistisch zu vergleichen. Das heisst also: Man fragt nicht, ob das Mentoring-Programm spezifisch zur Erhöhung der Karrierechancen von MitarbeiterInnen mit Migrationshintergrund beigetragen hat, sondern man schaut lediglich, ob diese Chancen im Allgemeinen zugenommen haben. Wenn ja, besteht zumindestens ein Risiko, dass die Streichung des Programms negative Folgen haben könnte: Nämlich alleine schon wegen der Signalwirkung auf die Erwartungen der betroffenen Personengruppe. Wenn es andererseits gar keine Verbesserung trotz des Programms gibt, wäre eine nähere Prüfung der Zusammenhänge ratsam.
Für diese Methode ist die MitarbeiterInnen-Befragung immer ein probates Instrument. Das schließt sogar die Messung der Zielerreichung der Organisation ein: Es macht durchaus Sinn, zwischen vermeintlich objektiven Kriterien der Zielerreichung (etwa Gewinngrößen) und den scheinbar subjektiven Wahrnehmungen der Mitglieder einer Organisation zu unterscheiden. Denn letztere sind besonders längerfristig ein Scharnier, das Anreize und Leistung verbindet. Wenn also beispielsweise kurzfristig Gewinne sinken, aber gleichzeitig die MitarbeiterInnen kommunizieren, dass ihrer Meinung nach die Leistung der Organisation sich verbessere, ist das ein wichtiger Indikator für das künftige Leistungspotenzial der Organisation. Korrelieren solche Beobachtungen mit der Einführung von DiM, gibt es also auch einen wichtigen Hinweis auf dessen Leistungsbeitrag. MitarbeiterInnen-Befragungen gewinnen noch eine besondere Bedeutung in Non-Profit-Organisationen, wo der Gewinn nicht als vordergründig leicht greifbarer Erfolgsindikator verwendet werden kann.
Diese Überlegung weist auf ein grundsätzliches psychologisches Phänomen hin, das für die Evaluation von DiM-Maßnahmen wichtig ist. Im Fokus von DiM stehen u.a. die negativen Auswirkungen von Stereotypen in zwischenmenschlichen Interaktionen. Nun gibt es aber unmittelbare Effekte der Wahrnehmung möglicher stereotypisierender Behandlung auf die individuelle Leistung: Wenn Mädchen fürchten, dass sie vom Stereotyp betroffen sein könnten, dass Mädchen in Mathematik schlechter sind als Jungen, fällt ihre Leistung ab, völlig unabhängig davon, ob eine solche Diskriminierung tatsächlich vorliegt. Dieser Effekt kann sogar bei jenen Mädchen besonders stark ausfallen, die besonders motiviert wären, eine hohe Leistung in Mathematik zu zeigen, aber deswegen auch leichter zu frustrieren sind. Im Extremfall stellt eine Mathematik-Lehrerin frustriert fest, dass die Mädchen in ihrer Klasse tatsächlich schlechter in Mathematik sind.
Dieser Zusammenhang ist sehr wichtig, um den holistischen Charakter von DiM-Maßnahmen zu begründen. Um beim Beispiel des Mentoring zu bleiben: Wenn es ein Mentoring-Programm gibt, kann seine Abschaffung sehr negative Wirkungen haben, wenn die der Gründe dafür nicht ausreichend kommuniziert werden. Wenn nicht glaubwürdig gezeigt werden kann, dass das Programm sozusagen seinen Dienst erfüllt hat, werden Befürchtungen geschürt, dass Stereotypen wieder mehr Platz greifen – was zu einer Leistungsminderung der betroffenen Personen führt, ohne dass jegliche Diskriminierung erfolgt.
Wie man sieht, die doppelten Kontingenzen sozialer Systeme stellen der Leistungsbewertung von DiM einige Fußfallen. Sie werden sogar zu einer Falle: Wer DiM einführt, kann kaum zurück, weil die Rücknahme der Maßnahmen endogen negative Effekte zeitigt, die unabhängig davon sind, welche positiven Wirkungen DiM hatte oder nicht hatte. Eines ist gewiß: Die Wirkungen einzelner Maßnahmen hängen immer vom Kontext ab. Eine Organisation, die keine Diversity-bewußte Kultur pflegt, wird kaum dazu in der Lage sein, einzelne DiM-Maßnahmen erfolgreich zu implementieren. Und die Rücknahme der Maßnahmen wird eher das allgemeine Bild zementieren, dass die Organisation Diversity nicht schätzt. Das ist sicherlich der wichtigste Grund, warum die Skepsis so verbreitet ist, was den Erfolgsbeitrag von DiM angeht – und warum es andererseits hinreichend viele Beispiele von Unternehmen gibt, die durchaus sehr erfolgreich strategisches DiM betreiben.
Die ‚Balanced Scorecard’ als Instrument strategischer Integration
Immerhin lassen sich einige quantitative Kennziffern auf den Tisch legen, sobald eine Organisation Diversity als strategischen Wert in ihre Leitvorstellungen aufnimmt. Klar: Wer für Chancengleichheit der Geschlechter steht, muß sich unangenehme Fragen gefallen lassen, wenn es auf der Leitungsebene keine Frau gibt. Ähnlich lassen sich viele Kennzahlen eines Diversity-Controlling definieren. Gegeben ist ein Ziel (etwa: Alters-Diversity positiv fördern), und gemessen wird die Zielerfüllung (also etwa, Anteil von älteren ArbeitnehmerInnen bei Neueinstellungen). Das ist sozusagen der komplementäre Ansatz zur oben skizzierten Mischung von quantitativen und qualitativen Methoden: Jetzt wird nämlich nicht mehr nach dem Zielbeitrag von Maßnahmen gefragt, sondern nur nach der Zielerfüllung.
Insofern kann man sagen, dass die DiM-Evaluierung auf zwei Zahlenwerken beruht, die sehr häufig nur qualitativ miteinander verbunden werden können: Erstens, Zahlen über DiM- Maßnahmen, also im Wesentlichen Kosten, und zweitens, Zahlen zur Diversity-Zielerfüllung, was im weiteren Sinne Erträge sind. Eine quantitative Verknüpfung würde häufig sogar einen kontraproduktiven Effekt haben: Typischerweise würde nämlich gefragt, wie sich die Zielerfüllung pekuniär bestimmen läßt. Die finanziellen Erträge werden dann automatisch auch zum prioritären Ziel erklärt. Das würde aber häufig, wie gesehen, in die Irre leiten.
Das zentrale Problem besteht also darin, diesen qualitativen Zusammenhang möglichst transparent und nachvollziehbar zu packen. Eines der möglichen Instrumente ist die ‚Balanced Scorecard’ (BSC) im strategischen Controlling. Die BSC wurde entwickelt, um möglichst viele unterschiedliche Leistungsindikatoren zueinander in Beziehung zu setzen, die sich auf einige wenige Schlüsselbereiche der Unternehmensleistung beziehen, wie beispielsweise die Kundenbeziehungen oder die Personalentwicklung. Wesentlich ist dabei der Prozeß der Erstellung der BSC: Hier geht es darum, eine Fülle von Hypothesen zusammenzustellen, wie die unterschiedlichen, bereichsspezifischen Maßnahmen zum Bereichs- und Gesamterfolg beitragen und wie sie zusammenwirken. Im Ergebnis erhält man eine komplexe Landkarte von Zusammenhängen, die in ein konkretes Zahlenwerk heruntergebrochen sind. Letzten Endes geht es bei gewinnorientierten Organisationen auch um den Beitrag zu Gewinnen und finanzieller Viabilität einer Unternehmung – es wäre völlig unrealistisch, diesen Gesichtspunkt im Zuge allgemeiner Diversity-Begeisterung zu übersehen. Aber mit Hilfe der BSC werden größere Zusammenhänge aufgespannt, in denen die oft komplexen Kausalketten überhaupt erst rekonstruiert werden können. Das gilt schon für traditionelle Anwendungen der BSC, erst recht dann für Diversity.
Hier ist kein Raum, die Details dieses Ansatzes darzustellen. (Vgl. detaillierte Darstellung in Wikipedia) Ich möchte nur betonen, dass erfolgreiches DiM eine ähnliche Vorgehensweise als Rahmenbedingung voraussetzt. Erst im Rahmen eines detaillierten strategischen Controlling ist es überhaupt möglich, den Stellenwert von Diversity zu definieren und dann DiM angemessen zu evaluieren. Zum Beispiel kann eine Standarddimension der Balanced Scorecard, die sogenannte ‚KundInnenperspektive’, natürlich sehr gut unter Diversity-Gesichtspunkten beleuchtet werden. Wer beispielsweise an einem durchschnittlichen Reisebüro vorbeischlendert, wird sicherlich feststellen, dass dort in der Regel gewisse Standards im Bereich der sexuellen Orientierung und der Gender-Thematik beachtet werden. Das erklärt sich durch die herkömmliche Fokussierung der wichtigsten KundInnengruppen, wie beispielsweise Familien oder junge heterosexuelle Paare. Nun mag ein Reiseunternehmen aber die Homosexuellen als Zielgruppe entdecken. In der Balanced Scorecard läßt sich ein solcher Schritt umfassend thematisieren und analysieren, etwa hinsichtlich von Kennzahlen zu einschlägigen Werbemaßnahmen oder, falls Daten verfügbar sind, der demographischen Veränderungen im KundInnenprofil.
Das Beispiel zeigt auch erneut, dass es unterschiedliche Zugangsweisen zu einer solchen Balanced Scorecard gibt. Die traditionelle Zugangsweise würde den Gewinnbeitrag von Maßnahmen betonen. Die explizite Berücksichtigung der sexuellen Orientierung leitet sich dann aus der Idee ab, eine zahlungskräftige KundInnengruppe zu erschließen (oft gut verdienend und kinderlos). Diversity kann aber auch zu einem strategischen Ziel aufrücken: Der Reiseveranstalter würde sich proaktiv den gesellschaftlichen Veränderungen stellen und die strategische Vision entwickeln, als Unternehmen diese Veränderungen zu begleiten und zu unterstützen. In diesem Fall kann die Maßnahme im Bereich ‚KundInnen’ nicht mehr alleine stehen. Vielmehr müsste es einen umfassenden Ansatz geben, der etwa auch das Personalmanagement auf allen Ebenen einschließt. Die letzte, radikalste Stufe bestünde darin, den Strategieprozess selbst im Lichte der Diversity zu gestalten. Denn die traditionelle BSC wird in der Regel von SpezialistInnen und von der Unternehmensleitung erstellt. Das kann bereits verhindern, dass Durchbrüche erzielt werden. Eine Öffnung des Strategieprozesses selbst ist letzten Endes unabdingbar, etwa durch die Einbeziehung von focus groups und von Stakeholdern.
Die Balanced Scorecard ist also eine der wichtigsten Methoden, das Dilemma der Messbarkeit des schwer Messbaren zu lösen. Das Dilemma wird nicht gelöst, indem ein Messverfahren entwickelt wird: Vielmehr wird der Prozess transparent und zielorientiert gestaltet, in dem mit diesem Dilemma umgegangen wird. Je offener dieser Prozess selbst wird, innerhalb der Unternehmung oder gar über die Grenzen der Unternehmung hinweg, desto eher dürfte gewährleistet sein, dass der Wissensstand über Leistungsbeiträge des DiM verbessert wird.
DiM als Komponente von Corporate Social Responsibility
Das Beispiel des Reiseunternehmens ist geeignet, die Tragweite der letzten Stufe zu illustrieren. Denn ein Reiseunternehmen kann sich letzten Endes nicht der Einsicht verschließen, dass seine Weise der KundInnenadressierung auch ein Teil der gesellschaftlichen Diversity-Prozesse ist. Werbung, die sich an eine Vielfalt von KundInnen mit unterschiedlicher sexueller Orientierung richtet, kann mehr zum Wertewandel beitragen, als so manche gesellschaftspolitische Bildungsmaßnahme. Insofern muß DiM immer auch im Zusammenhang von Corporate Social Responsibility (CSR) gesehen werden, was auch die Evaluation berührt. Auch diese weitere Erhöhung der Komplexität läßt sich am besten mit Methoden wie der BSC auffangen. Für Maßnahmen der CSR gilt natürlich alles vorher Gesagte in ähnlicher Weise. Auch hier sind die Kosten leicht greifbar, die Erträge diffus.
Insofern ist abschließend zu betonen, dass die Art und Weise der Leistungsmessung selbst ein Faktor im Diversity-Prozess ist. Eindimensionalität der Leistungsmessung unterdrückt Diversity als dynamische Kraft, so oder so. Die Vielfalt der Methoden ist auch Bedingung für die angemessene Bewertung von DiM.
Literaturhinweise
Zur Frage der Messung des Nutzens von DiM (etwa: Leistung von Teams, Zufriedenheit der MitarbeiterInnen, Wirkung von DiM Maßnahmen):
- Anand, Rohini / Winters, Mary-Francis (2008): A Retrospective View of Corporate Diversity Training From 1964 to the Present, Academy of Management Learning & Education, Vol. 7(3): 356-372.
- Chartered Institute of Personnel and Development (2006): Managing Diversity. Measuring Sucess, London.
- Choi, Sungjoo / Rainey, Hal G. (2010): Managing Diversity in U.S. Federal Agencies: Effects of Diversity and Diversity Management on Employee Perceptions of Organizational Performance, Public Administration Review January/February 2010: 109-121.
- Fischer, Michael (2007): Diversity Management and the Business Case. HWWI Research Paper 3-11.
Zur Psychologie von DiM und Stereotypen:
- Roberson, Lorann / Kulik, Carol T. (2007): Stereotype Threat at Work, Academy of Management Perspectives May 2007: 24-40.
Zur strategischen Dimension von DiM:
- Schulz, André (2009): Strategisches Diversitätsmanagement. Unternehmensführung im Zeitalter der kulturellen Viefalt. Wiesbaden.
Zur Rolle von DiM im Personalmanagement:
- Shen, Jie et al. (2009): Managing Diversity through Human Resource Management: An International Perspective and Conceptual Framework, The International Journal of Human Resource Management Vol. 20(2): 235-251.
DiM und Diversity Controlling / Balanced Scorecard
- Herrmann-Pillath, Carsten (2009): Diversity Management und diversitätsbasiertes Controlling: Von der „Diversity Scorecard“ zur „Open Balanced Scorecard“, in: F. Wall und R. Schröder, eds., Controlling zwischen Shareholder Value und Stakeholder Value, München, 149-177
- Hubbard, E.E. (2004): The Diversity Scorecard. Evaluating the Impact of Diversity on Organizational Performance, Burlington / Oxford.
- Köppel, Petra / Spie, Ulrich (2010): Vielfalt gewinnt, Personal Heft 03/2007: 38-41.
Carsten Herrmann-Pillath ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management und Leiter des East West Centre for Business Studies and Cultural Science. Als Volkswirt und Sinologe verbindet er Ökonomie und Kulturwissenschaft in seiner Arbeit.