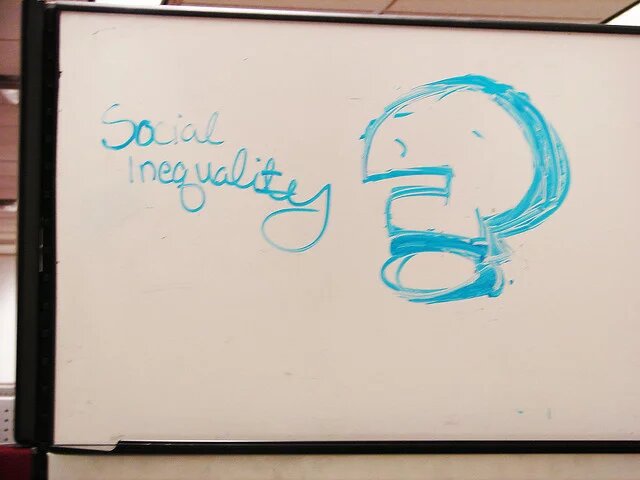
von Andrä Wolter
Ungleichheit in der Hochschulbildung: kein neues Thema
Bereits seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert ist bekannt, dass die Chance, ein Studium aufzunehmen, in hohem Maße von der sozialen Herkunft abhängt. Die soziale Ungleichheit beim Zugang zu bzw. in der Beteiligung an Hochschulbildung ist ein in den letzten Jahrzehnten immer wieder – in gewissen Wellen, oft im Kontext eines vorhandenen oder bevorstehenden Fachkräftemangels – thematisiertes Problem. Das Problem hat keineswegs an Aktualität verloren trotz des massiven sozialstrukturellen und bildungspolitischen Wandels, der sich seit jener Zeit vollzogen hat.
Die sozialen Klassen- und Gruppenstrukturen haben sich mit dem Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft fundamental verändert. Institutionelle Barrieren im Schulsystem sind beseitigt worden. Heute existiert eine gemeinsame Grundschule, es muss kein Schulgeld für höhere Bildung mehr gezahlt werden, Aufnahmeprüfungen zum Gymnasium finden nicht mehr statt. Ein Wechsel in die gymnasiale Oberstufe ist inzwischen auch von der Realschule möglich. Die Wege zur Studienberechtigung sind vielfältig geworden (z. B. über berufsbildende Schulen). Eine öffentliche Studienförderung zugunsten von Studierenden aus wirtschaftlich schwächeren Familien soll finanzielle Hürden bei der Studienaufnahme beseitigen.
Und in der Tat hat die Beteiligung an Hochschulbildung seit 1900 etwa um den Faktor 40 zugenommen. Betrug die Studienanfängerquote um 1900 herum etwa 1 %, so liegt sie heute bei weit über 40 % (wenn auch statistisch verzerrt durch die doppelten Abiturientenjahrgänge). Aber trotz der enormen Expansion der Bildungsbeteiligung in den letzten fünf Jahrzehnten sind die sozialen Disparitäten keineswegs verschwunden. Im langfristigen Zeitvergleich haben sie abgenommen; der Arbeiterkinderanteil, klassischer Indikator für soziale Ungleichheit in der Hochschulbildung, lag vor dem Ersten Weltkrieg bei etwa 3 % (Kaelble 1975), heute bei 20 % (Isserstedt u. a. 2010, S. 127).
Oft wird darauf verwiesen, dass es „das Arbeiterkind“ angesichts der Auflösung des klassischen industriellen Arbeitermilieus gar nicht mehr gäbe. Das geht am Kern des Problems vorbei, weil die Disparitäten heute in anderer Form auftreten (dazu später mehr). Die Frage, ob mit der Bildungsexpansion die soziale Ungleichheit in der Beteiligung an (Hochschul-)Bildung zu- oder abgenommen hat oder gleichgeblieben ist, wird in der Bildungsforschung kontrovers diskutiert, abhängig von der Definition und Messung. Kein Zweifel besteht aber daran, dass die soziale Struktur des Hochschulzugangs immer noch durch erhebliche soziale Schieflagen gekennzeichnet ist. Um Maßnahmen zu diskutieren, die für einen Abbau dieser Schieflagen geeignet sind, ist zunächst jedoch eine Bestandsaufnahme und Ursachenanalyse erforderlich.
Das Schulsystem als zentrale Zuweisungsagentur
Angesichts der methodischen Fortschritte in der empirischen Forschung verfügen wir heute über sehr viel genauere Einsichten in die Zusammenhänge zwischen sozialer bzw. familiärer Herkunft, Lernprozessen und Bildungsverläufen. Lange Zeit stützte man sich vorrangig auf Daten zur sozialen Zusammensetzung von StudienanfängerInnen oder Studierenden und verglich diese mit der Zusammensetzung der Bevölkerung (so etwa Ralf Dahrendorf in seiner klassischen Studie aus dem Jahr 1965; vgl. auch Peisert 1967). Heute ist es möglich, recht genau sozialgruppenspezifische Bildungsbeteiligungsquoten berechnen. Die – positive oder negative – Studienentscheidung und die dabei wirksamen individuellen und sozialen Bedingungen können multivariat abgebildet (vgl. hierzu u. a. Maaz 2006; Becker/Lauterbach 2004).
Die Population derjenigen, die ihre Schulzeit mit dem Erwerb einer Studienberechtigung abschließen und aus denen sich dann die StudienanfängerInnen rekrutieren, bildet eine bereits hochgradig nach sozialen Merkmalen vorgefilterte Gruppe. Die Schwelle der Hochschulzuassung bildet zwar auch einen sozial wirksamen Filter. Der eigentliche Filterungsprozess findet aber nicht an dieser Stelle statt, sondern erstreckt sich über den ganzen vorangegangenen vorschulischen und schulischen Bildungsverlauf. Soziale Selektivität wird dadurch bio-graphisch kumulativ stufenweise aufgebaut. Von daher ist die Selektionsfunktion des Hochschulzugangs gegenüber der des Schulsystems und der bisherigen Schulkarriere vergleichsweise schwach ausgeprägt, auch wenn ihr eine verstärkende Funktion zukommt. Während in vielen anderen Staaten mit einem horizontal aufgebauten Schulsystem Zugang und Zulassung zum Studium die wichtigste Selektionsstufe darstellen, wird ein großer Teil dieser Selektionslast in Deutschland vom Hochschulzugang auf das gegliederte Schulsystem verschoben, in dem die Wege zur Hochschulreife über besondere Einrichtungen führen, die nur einem Teil der Jugendlichen zugänglich sind.
Mit der schon vor beinahe vier Jahrzehnten eingeführten Unterscheidung zwischen primären und sekundären Herkunftseffekten (Boudon 1974) lassen sich die Größenordnungen genauer angeben, in denen die Allokation im Schulsystem von kompetenzunabhängigen sozialen Einflüssen abhängig ist. Als primäre Ungleichheit werden – zugespitzt formuliert – die Einflüsse der sozialen Herkunft auf die individuelle Kompetenzentwicklung (z.B. kognitive oder sprachliche Fähigkeiten) bezeichnet, als sekundäre Ungleichheit die Unterschiede in den familiären Bildungsentscheidungen, die durch die soziale Zugehörigkeit hervorgerufen werden. Beide Komponenten sind aber keineswegs unabhängig von intervenierenden schulischen Faktoren. Auf der Basis der ersten drei PISA-Studien lässt sich sagen, dass unter Kontrolle der kognitiven Grundfähigkeiten und der Lesekompetenz die relative Chance eines Kindes aus der oberen Dienstklasse, ein Gymnasium zu besuchen, etwa 2,2 (2006) bis 2,8 (2000) mal so hoch war wie die eines Facharbeiterkindes – anders formuliert: bei gleicher kognitiver Fähigkeit und Lesekompetenz (PISA-Konsortium Deutschland 2007, S. 330).
Offensichtlich entscheiden entgegen der Selbstlegitimation des gegliederten deutschen Schulsystems nicht allein Begabung, Eignung oder Kompetenz, sondern eben auch die soziale Herkunft über den Bildungsverlauf. Danach gibt es ein nicht unbeträchtliches zusätzliches Potenzial in der Bevölkerung, das von der individuellen Kompetenz her in der Lage wäre, ein Gymnasium zu besuchen, diesen Schritt aber primär aufgrund familiärer (oder schulischer) Entscheidungen nicht vollzieht. Hierfür ist der Begriff „underachievement“ eingeführt worden (Solga/Dombrowski 2009, S. 9). Die Gründe und Ursachen sind komplex, sie liegen ebenso in mangelnder Förderung und Unterstützung durch die Familie wie durch die Schule. Selbsteliminierung (z.B. Verzicht auf ein Studium) spielt eine wichtige Rolle.
Der Hochschulzugang als zusätzliche Schwelle
Wenn auch schon vieles während der Schulzeit passiert, so stellt der Hochschulzugang doch eine zusätzliche Barriere dar. Denn selbst unter denjenigen, die ihre Schulzeit erfolgreich mit dem Abitur abschließen und die ja schon eine nach sozialen Herkunftsmerkmalen „vorgesiebte“ Gruppe darstellen, variiert die Studienentscheidung noch mit der Herkunft. Auch beim Hochschulzugang greifen primäre und sekundäre Mechanismen ineinander. So wird die Entscheidung, ein Studium aufzunehmen oder eine berufliche Alternative (ohne Studium) zu wählen, zwar in erster Linie von der Schulleistung, gemessen über die Abiturdurchschnittsnote, bestimmt.
Unter Kontrolle der Schulleistung (also bei gleicher Durchschnittsnote) und anderer Faktoren ergibt sich aber noch ein signifikanter Einfluss des Bildungsstatus der Herkunftsfamilie auf die Studienentscheidung. Kinder aus Akademikerfamilien nehmen auch dann häufiger ein Studium auf, wenn ihre Schulleistungen unterdurchschnittlich sind. Dagegen verzichten Kinder aus Familien ohne akademische Tradition häufiger auf ein Studium, selbst wenn ihre Leistungen überdurchschnittlich ausfallen. Die Studierwahrscheinlichkeit variiert zwischen den Jugendlichen, bei denen mindestens ein Elternteil über einen Hochschulabschluss verfügt, und denjenigen, deren Eltern höchstens einen Lehrabschluss erwarben, bei gleicher Abiturnote um gut 20 Prozentpunkte (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, S. 119; ähnlich Lenz/Wolter/Rosenkranz 2010).
Ein Hauptgrund für einen Studienverzicht sind neben anderen beruflichen Interessen finanzielle Erwägungen, der Wunsch, möglichst schnell eigenes Geld zu verdienen, ebenso wie die Befürchtung, ein Studium übersteige die eigenen finanziellen Möglichkeiten. Erwartungsgemäß ist dies vor allem in Familien ohne akademischen Bildungshintergrund der Fall. Hier kann die Frage der Studienfinanzierung entscheidungsrelevant werden (Heine 2011). Die Bedeutung von Studiengebühren für die Studienentscheidung und ihre „abschreckende“ Wirkung werden allerdings oft überschätzt. Für die Mehrzahl der Studienberechtigten, die eine feste Studienabsicht verfolgen, sind Studiengebühren (in den jetzigen Beträgen) kein Hinderungsgrund; die Eltern sind in der Lage sie zu bezahlen. Aber für diejenigen sozialen Gruppen, die häufiger auf ein Studium verzichten, sind Studiengebühren gewiss kein Anreiz, sich anders zu entscheiden. Studiengebühren treffen gerade diejenigen Gruppen besonders, die schon jetzt aus finanziellen Gründen häufiger auf ein Studium verzichten. Hierbei dürfte es sich um eine Gruppe handeln, die sich auf 5 bis 10 % aller Studienberechtigten beläuft. Insgesamt dürften die Kosten eines Studiums gegenwärtig für etwa 15 bis 20 % der Studienberechtigten eine entscheidungsrelevante Frage darstellen.
Auf zwei weitere soziale Faktoren ist hinzuweisen, die einen Einfluss auf die Studierchancen ausüben, auf das Geschlecht und den Migrationsstatus. Seit den 1960er Jahren hat der Anteil der Frauen unter den StudienanfängerInnen kontinuierlich zugenommen. Die wachsende Beteiligung der Frauen ist sogar eine der zentralen Triebkräfte der Hochschulexpansion gewesen. Inzwischen beträgt der Anteil der Frauen an den AbiturientInnen in Deutschland gut 55 %. Aufgrund ihrer niedrigeren Übergangsquote in das Hochschulsystem liegt die Studienanfängerquote der Frauen zwar um einige Prozentpunkte unterhalb ihres Anteils an den Studienberechtigten. Aber seit mehr als 10 Jahren bilden Frauen die Mehrheit unter den StudienanfängerInnen an den Universitäten.
Das Hauptproblem liegt hier weniger in der Diskriminierung der Frauen beim Studienzugang als in den ausgeprägten geschlechtsspezifischen Disparitäten in der Studienfachwahl. Und ein noch größeres Problem sind die geschlechtsspezifischen Diskrepanzen in den Beschäftigungschancen und Gehaltsstrukturen nach Studienabschluss (vgl. Leuze/Strauss 2009; Lenz/Wolter/Jahn 2009, Kapitel 6). Mehr und mehr werden die akademisch qualifizierten Frauen zum wichtigsten Humankapitalpotenzial in Deutschland.
Angesichts der Befunde aus der empirischen Schulforschung zu den Bildungsverläufen von MigrantInnen nicht sonderlich überraschend ist die starke Unterrepräsentanz von Studierenden mit Migrationsstatus im deutschen Hochschulsystem. In der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist die Beteiligung an Hochschulbildung deutlich niedriger als in der Bevölkerung ohne Migrationsstatus (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010, S. 124).(1) Auch hier wird die Benachteiligung kumulativ im Schulsystem aufgebaut und nicht beim Hochschulzugang erzeugt. Unter denjenigen MigrantInnen, die eine Studienberechtigung erworben haben, ist die Studierbereitschaft sogar eher höher als unter den Studienberechtigten ohne Migrationshintergrund (Konsortium Bildungsberichterstattung 2006, S. 157). Dabei ist es wichtig zu sehen, dass Studierende mit Migrationsstatus eine äußerst heterogene Gruppe darstellen. Den höchsten Anteil unter den Studierenden erreichen diejenigen, die inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben, während die sogenannten BildungsinländerInnen (Studierende mit deutscher Studienberechtigung, aber nicht-deutscher Staatsbürgerschaft) stark unterrepräsentiert sind. Große Unterschiede gibt es nach nationaler Herkunft.
Beteiligung an Hochschulbildung und soziale Chancenstrukturen
Das Ergebnis dieses über verschiedene Schwellen verlaufenden Selektionsprozesses ist eine massive Verzerrung der Wahrscheinlichkeiten in der Beteiligung an Hochschulbildung. Ein methodisch elaboriertes Verfahren, soziale Disparitäten und die unterschiedlichen sozialen Chancenstrukturen in der Beteiligung an Hochschulbildung zu messen, hat die Sozialerhebung entwickelt (zuletzt Isserstedt u. a. 2010, S. 100 ff.). Die soziale Differenzierung der Studierchancen verläuft nicht mehr primär entlang der Unterscheidung zwischen ArbeiterInnen, Angestellten, BeamtInnen und Selbständigen, sondern entlang des Merkmals, ob die Eltern (oder ein Elternteil) bereits über einen Hochschulabschluss verfügen oder nicht. Während im Jahr 2007 71 % aller Kinder aus einer akademisch vorgebildeten Familie (in der entsprechenden Altersgruppe) ein Studium aufnahmen, waren es unter den Kindern aus Familien ohne akademische Tradition nur 24 %. Die beiden Gruppen mit den höchsten Beteiligungsquoten beim Hochschulzugang – Kinder aus Beamten- oder aus Selbständigenfamilien, in denen mindestens ein Elternteil ein Studium absolviert hat – weisen mit 84 bzw. 87 % eine fünf Mal so hohe Studierquote auf wie die Gruppe mit der niedrigsten Beteiligungsquote, den Kindern aus Arbeiterfamilien (17 %).
Leider verfügen wir in Deutschland in der Altersgruppe der 19- bis 23jährigen bislang über keine für die gesamte Altersgruppe repräsentativen Kompetenzmessungen (anders als bei PISA für die 15jährigen). Von daher ist es zur Zeit noch nicht möglich, diese Zusammenhänge über die gesamte Altersgruppe auch unter Kontrolle von Kompetenzmessungen auszuweisen. Die Unterschiede würden nicht verschwinden, aber kleiner ausfallen.
Inzwischen kommt mehr als die Hälfte der Studierenden aus einer Familie mit akademischem Hintergrund, an den Universitäten (56 %) deutlich mehr als an den sozial offeneren Fachhochschulen (40 %) (Isserstedt u. a. 2010, S. 125 ff.). Dieser Anteil steigt in dem Maße, in dem die Eltern bereits von früheren Wellen der Bildungsexpansion profitiert haben. Die Universität wird tendenziell immer mehr zu einer Institution, die nicht mehr primär dem Bildungsaufstieg, sondern der „Vererbung“ eines bereits erreichten akademischen Status in der jeweils nachfolgenden Generation dient. Das familiäre Bildungskapital wird zur wichtigsten „Ressource“ für die Aufnahme eines Studiums. Auch wenn finanzielle Motive als Grund gegen die Aufnahme eines Studiums eine Rolle spielen, so ist es doch nicht in erster Linie das ökonomische Kapital, sondern das Bildungskapital, welches die Entscheidung für oder gegen ein Studium beeinflusst (Wolter 2005; siehe auch Fußnote 2). Die Differenzierungslinie im Blick auf die Beteiligung an akademischer Bildung verläuft primär zwischen denjenigen Familien, die bereits über eine akademische Vorbildungstradition verfügen, und denjenigen, für die das nicht gilt. Universität und Studienaufnahme gewinnen offenkundig stärker als je zuvor eine familiäre Reproduktionsfunktion.
Im europäischen Vergleich zeigen sich deutliche Unterschiede (HIS 2008, S. 55 ff.). Zwar liegt die Studierbeteiligung von Jugendlichen aus Familien mit einem höheren Bildungshintergrund in allen 23 Staaten, die an der Eurostudent-Studie III teilgenommen haben, höher, als es nach ihrem Bevölkerungsanteil zu erwarten gewesen wäre. Am höchsten fällt sie in einigen osteuropäischen Staaten, Portugal, der Türkei, in Frankreich und Deutschland (2,03) aus. Auf der anderen Seite gibt es einige Staaten, in denen die Beteiligung von Studierenden aus Familien mit niedrigem Bildungshintergrund beinahe ihrem Bevölkerungsanteil entspricht. Dies ist in u. a. in den Niederlanden, in Finnland und der Schweiz der Fall. Zumindest gemessen an diesem Kriterium erweisen sich die Hochschulsysteme dieser Staaten als relativ offen, während Deutschland einen der ungünstigsten Beteiligungswerte aufweist (0,4).
Bildungspolitische Maßnahmen zur Erhöhung der sozialen Durchlässigkeit des Hochschulzugangs
Deutschland zählt zu den Staaten, die sich im internationalen Vergleich durch eine besonders enge Kopplung von Bildungsabschlüssen, Zertifikaten und Berechtigungen auf der einen Seite, beruflichen Zugängen, Beschäftigungs- und Lebenschancen auf der anderen Seite auszeichnen. Insoweit der Hochschulzugang den Zugang zu den herausgehobenen beruflichen und sozialen Positionen in einer Gesellschaft eröffnet, gewinnt gerade hier die Frage nach den sozialen Allokations- und Distributionsmechanismen eine besondere Prominenz. Von daher wird die soziale Schieflage beim Hochschulzugang von vielen normativ unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit kritisiert – nicht zuletzt eben auch aufgrund der Tatsache, dass von einer begabungsgerechten Selektion im Schulsystem nicht die Rede sein kann (siehe Abschnitt 2).
Ebenso wichtig ist ein anderes Argument: Das deutsche Bildungssystem verschenkt Talente – ökonomisch gesprochen: Ressourcen –, auf die unsere Gesellschaft im Zeichen der wissensgesellschaftlichen Modernisierung von Arbeit, Beschäftigung und Wertschöpfung dringend angewiesen ist. In Deutschland gibt es inzwischen einen Konsens, wonach es erforderlich ist, die Studienanfänger- und Hochschulabsolventenquoten zu erhöhen, um dem Strukturwandel zu humankapitalintensiver Wertschöpfung Rechnung zu tragen. Dafür müssen gerade diejenigen Potenziale aktiviert werden, die bislang nur in bescheidenem Umfang an Hochschulbildung partizipieren konnten. Diese Potenziale lassen sich eingrenzen: Jugendliche aus „bildungsfernen“ Gruppen (2) unter Einschluss von Migranten, eine noch stärkere Mobilisierung der jungen Frauen beim Hochschulzugang und eine stärkere Öffnung des Hochschulzugangs für nicht-traditionelle Studierende (vgl. hierzu Wolter 2010, 2011). (3)
Ohne Zweifel wird die aktuelle Thematisierung der Frage der Studierchancen und ihrer sozialen Verteilung von der Befürchtung mitgetragen, dass sich die Diskrepanz zwischen einem im internationalen Vergleich ohnehin schon niedrigen Angebot an HochschulabsolventInnen und einem steigenden Bedarf an hochqualifizierten Fachkräften zu einem internationalen Wettbewerbsnachteil unter den Bedingungen einer in zunehmenden Maße wissensbasierten Ökonomie auswächst.
Wie kann soziale Selektion beim Hochschulzugang abgebaut und eine größere Durchlässigkeit des Hochschulzugangs erreicht werden? Aus der vorangegangenen Analyse ergibt sich, dass der strategische Ansatzpunkt hierfür zunächst gar nicht an der Schnittstelle des Hochschulzugangs selbst liegt, sondern an den zentralen Übergängen und den Verläufen im Schulsystem. Ein höheres Maß an Chancengerechtigkeit beim Hochschulzugang wäre primär über ein höheres Maß an Chancengerechtigkeit im Schulsystem zu realisieren. Maßnahmen, den Hochschulzugang für nicht-traditionelle Studierende (den sog. Dritten Bildungsweg) weiter zu öffnen, sind schon allein wegen ihrer begrenzten statistischen Größenordnungen nur bedingt geeignet, die schulisch kumulativ aufgebauten verzerrten Chancenstrukturen nachträglich zu korrigieren. Solche Bildungswege, die gleichsam eine zweite Chance eröffnen, können zwar eine individuelle Ventil-, aber keine soziale Kompensationsfunktion erfüllen. Das zentrale Argument für die Förderung solcher alternativer Bildungswege ist weniger das Argument der Chancengleichheit als vielmehr das der Gleichwertigkeit zwischen allgemeiner Schul- und beruflicher Bildung.
Da der Schwerpunkt dieses Beitrags auf dem Hochschulzugang und nicht auf dem Schulsystem liegt, sollen hier nur einige wenige allgemeine Erläuterungen zu möglichen schulischen Maßnahmen gegeben werden. Im Schulsystem ginge es vor allem darum, primäre und sekundäre Herkunftseffekte zu reduzieren. Primären Herkunftseffekten kann in erster Linie durch eine frühere und bessere vorschulische und schulische Förderung der individuellen Kompetenzentwicklung vorgebeugt werden, insbesondere im Bereich der für Schulerfolg ausschlaggebenden Sprachkompetenzen. Sekundäre Effekte können vermindert werden durch eine intensivere Kooperation und Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus mit dem Ziel, schulische und familiäre Allokationsentscheidungen zu optimieren. Angesichts einer insgesamt keineswegs befriedigenden prognostischen Validität der Leistungsbewertung und der daran geknüpften Übergangsentscheidungen nach der bzw. in der vierten Klassenstufe gilt es insbesondere, die Kompetenzen von LehrerInnen in der pädagogischen Diagnostik zu erweitern.
Schulstrukturell stellt sich die Frage nach dem geeigneten Zeitpunkt, an dem Übergangs- und Allokationsentscheidungen getroffen werden. Wissenschaftlich gibt es hierauf keine eindeutige Antwort. Aber eine Verlängerung der gemeinsamen Schulzeit über die bisherige vierjährige Grundschule hinaus in Verbindung mit Konzepten und Maßnahmen stärkerer individueller Förderung würde dazu beitragen, die prognostische Validität schulischer Leistungsbeurteilungen im Blick auf Bildungslaufbahnentscheidungen zu erhöhen. Insgesamt gilt es die individuelle Förderungsfunktion des Schulsystems gegenüber dessen Verteilungsfunktion zu stärken.
Einen weiteren Ansatzpunkt bietet der Übergang in die gymnasiale Oberstufe nach Abschluss der Sekundarstufe I. Zu einer höheren Durchlässigkeit würde insbesondere der Ausbau von Wegen zur Hochschule beitragen, die über die gymnasiale Oberstufe beruflicher Bildungseinrichtungen (z. B. Berufs-/Fachgymnasien) führen, da es einige empirische Evidenz dafür gibt, dass solche Wege zur Hochschulreife weniger selektiv sind als die reguläre gymnasiale Oberstufe.
Aber auch für Maßnahmen, die direkt am Hochschulzugang ansetzen, gibt es durchaus Ansatzpunkte. So wäre es wichtig, sekundäre Ungleichheitseffekte beim Hochschulzugang zu reduzieren, also gerade auch diejenigen Studienberechtigten für ein Studium zu gewinnen, die eher dazu tendieren, auf ein Studium zu verzichten – angesichts der Bedeutung der sozialen Herkunft für die Studienentscheidung. In der kritischen Entscheidungssituation über den nachschulischen Ausbildungsweg sollten Beratung und Unterstützung durch die verschiedenen Einrichtungen der Studien- und Berufsberatung intensiviert werden.
Darüber hinaus müssten die finanziellen Hürden für eine Studienaufnahme verringert werden, wofür insbesondere der Erhalt und zielgruppenspezifische Ausbau der öffentlichen Studienförderung erforderlich ist. In einer nicht unbeträchtlichen Größenordnung brechen Studierende aus finanziellen Gründen ein Studium ab, auch wenn dies nicht der einzige, auch nicht der wichtigste Grund für die Aufgabe eines Studiums ist (Heublein/Wolter 2011). Alle Studierenden, die einen Anspruch auf eine öffentliche Studienförderung haben, sollten von Studiengebühren freigestellt werden. Dass Studienberechtigte trotz Eignung und Interesse aus finanziellen Gründen auf ein Studium verzichten oder ein Studium abbrechen, darf nicht vorkommen.
Februar 2011
Endnoten
(1) Studierende, die zum Studium aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, werden hierbei nicht berücksichtigt. Studierende mit Migrationshintergrund sind hier solche, die (a) der weiten Migrationsdefinition des Mikrozensus entsprechen und (b) das deutsche Schulsystem absolviert und ihre Studienberechtigung in Deutschland erworben haben.
(2) Dass der oft kritisierte Begriff „bildungsfern“ empirisch nicht falsch ist, zeigt die klare Differenzierung der Studierchancen entlang des Merkmals „Herkunft aus einem Elternhaus mit oder ohne akademischen Status“.
(3) Neben diesen endogenen Potenzialen ist eine weitere Maßnahme die Zuwanderung Hochqualifizierter aus dem Ausland (bzw. der Verbleib ausländischer Absolventen und Absolventinnen in Deutschland).
Literatur
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2010): Bildung in Deutschland 2010. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Auswirkungen der demografischen Entwicklung auf das Bildungswesen. Bielefeld.
- Becker, R./Lauterbach, W. (Hrsg.) (2004): Bildung als Privileg? Wiesbaden.
- Boudon, R. (1974): Education, Opportunity, and Social Inequality. Changing Prospects in Western Society. New York.
- Dahrendorf, R. (1965): Arbeiterkinder an deutschen Universitäten. Tübingen.
- Heine, C. (2011): Soziale Ungleichheiten beim Hochschulzugang. Düsseldorf (Hans-Böckler-Stiftung). Im Erscheinen.
- Heublein, U./Wolter, A. (2011): Studienabbruch in Deutschland. Definition, Häufigkeit, Ursachen, Maßnahmen. Erscheint in: Zeitschrift für Pädagogik. 57 Jg. Heft 2.
- HIS, Hochschul-Informations-System (2008): Social and Economic Conditions of Student Life in Europe. Eurostudent III 2005-2008. Bielefeld.
- Isserstedt, W./Middendorf, E. u. a. (2010): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2009. Bonn/Berlin.
- Kaelble, H. (1975): Chancenungleichheit und akademische Ausbildung in Deutschland. In: Geschichte und Gesellschaft. 1. Jg. S. 121-149.
- Konsortium Bildungsberichterstattung (2006): Bildung in Deutschland. Ein indikatorengestützter Bericht mit einer Analyse zu Bildung und Migration. Bielefeld.
- Lenz, K./Wolter, A./Rosenkranz, D. (2010): Trendwende? Studierneigung steigt erstmals wieder seit 2004. Dresden (TU Dresden).
- Lenz, K./Wolter, A./Jahn, A. (2009): Studienwahl: Ingenieurwissenschaften. Eine Expertise zu Studiennachfrage und Absolventenangebot in Deutschland und im Freistaat Sachsen. Dresden (TU Dresden).
- Leuze, K./Strauss, S. (2009): Lohnungleichheiten zwischen Akademikerinnen und Akademikern. In: Zeitschrift für Soziologie. 38 (Heft 4). S. 262-281.
- Maaz, K. (2006). Soziale Herkunft und Hochschulzugang. Effekte institutioneller Öffnung im Bildungssystem. Wiesbaden.
- Peisert, H. (1967). Soziale Lage und Bildungschancen in Deutschland. München.
- PISA-Konsortium Deutschland (Hrsg.) (2007): PISA 06. Die Ergebnisse der dritten internationalen Vergleichsstudie. Münster.
- Solga, H./Dombrowski, R. (2009): Soziale Ungleichheiten in schulischer und außerschulischer Bildung. Düsseldorf (Hans-Böckler-Stiftung).
- Wolter, A. (2005): Der lange Arm der Familie. Studieren unter dem Einfluss der sozialen Herkunft. In: Nave-Herz, R./Scholz, W.-D. (Hrsg.): Beiträge zur Bildungs- und Familienforschung. Würzburg. S. 11-38.
- Wolter, A. (2010): Durchlässigkeit zwischen beruflicher Bildung und Hochschulzugang – Vom Besonderheitenmythos zur beruflichen Kompetenz. In: Birkelbach, K./Bolder, A./Düsseldorf, K. (Hrsg.): Berufliche Bildung in Zeiten des Wandels. Festschrift für Rolf Dobischat zum 60. Geburtstag. Baltmannsweiler. S. 199-219.
- Wolter, A. (2011): Nicht-traditionelle Studierende in Deutschland. Ein Beitrag zur Durchlässigkeit des Hochschulzugangs. In: Quaisser, G./Gützkow, F. (Hrsg.): Jahrbuch Hochschule gestalten 2010. Bielefeld. Im Erscheinen.
Andrä Wolter, Dr. phil., ist Professor für Erziehungswissenschaftliche Forschung zum tertiären Bildungsbereich an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er ist Mitglied der Autorengruppe des Nationalen Bildungsberichts in Deutschland.