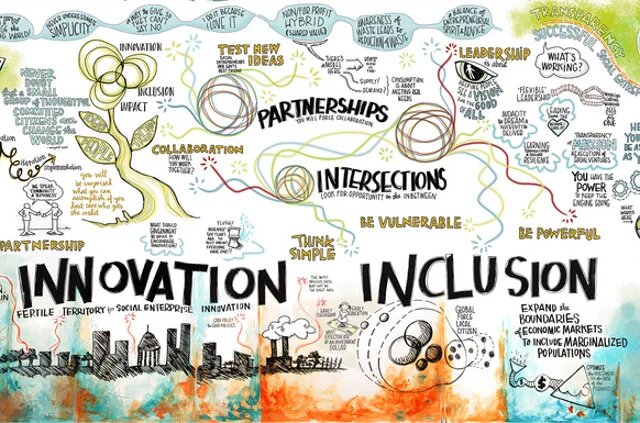
von Margret Bülow-Schramm und Hilke Rebenstorf
Die Selektivität beim Hochschulzugang – diverse Zugänge bringen alleine keine Diversität
Neben der Schaffung eines europäischen Hochschulraumes bestanden weitere dezidierte Ziele der Bologna-Reform darin, die Studierendenquote zu erhöhen und die Abbrecherquote zu senken sowie die Möglichkeiten des Studienzugangs und damit des Erwerbs eines Hochschulabschlusses zu verbreitern. Neben dem üblichen gradlinigen Pfad Schule – Abitur – Hochschule sollten weitere Zugangswege eröffnet werden. Diese sollten insbesondere Mitglieder nicht-akademischer Schichten und Menschen mit Migrationshintergrund zur Aufnahme eines Studiums ermutigen.
Mit der Diversifizierung der Studierendenschaft und der Zunahme unterschiedlicher Bildungswege, die geprägt sind von gesellschaftlichen Mechanismen der In- und Exklusion, gilt es, den Gegenpol der Schließung, nämlich die Durchlässigkeit zwischen den Bildungsinstitutionen (insbesondere zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung) vor dem Hintergrund ihrer gesellschaftspolitischen und ökonomischen Konsequenzen zu beleuchten und zu fragen, wie man die Durchlässigkeit und die Studierendenzahlen erhöhen kann, auch eine Zielgröße des Maastricht-Kommuniqués von 2004 (Tessaring/Wannan 2004).
Spätestens seit der 18. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (Isserstedt et al. 2007) und ihrer Präsentation auf der Wissenschaftskonferenz der GEW (Middendorf 2008) ist die Selektivität beim Hochschulzugang skandalisiert. Betrachtet man die Bildungs- und Studierchancen, so ist ihr Unterschied zwischen Arbeiter- und Beamtenkindern in den letzten 20 Jahren zwar geringer geworden: sie sind 2005 für Beamtenkinder nur noch 3,6 mal so hoch wie für Arbeiterkinder (1985 betrug dieser Faktor noch 6). Dennoch bestehen nach wie vor große Disparitäten in der sozialen Zusammensetzung der Studierenden. Der Anteil der Studierenden mit akademischem Hintergrund erhöhte sich von 36% in 1985 auf 51% in 2006.
Der Anteil derer, die aus Arbeiterhaushalten kommen, reduzierte sich von 42% auf 27% (ebd.). Dahinter verbirgt sich einerseits die erfreuliche Tatsache, dass der Anteil der Hochgebildeten in der Bevölkerung insgesamt gestiegen ist. Andererseits sind es hochschulinterne Einflussgrößen wie Verweildauer (die ist bei BAFöG-Beziehern geringer), Studienabbruch oder Studienwechsel, die Einfluss auf die Zusammensetzung haben. Neue Modelle der Studienförderung tun ein Übriges: sie verstärken die soziale Auslese durch die Schule, indem sie Schulnoten und Studierfähigkeit zur Voraussetzung für Stipendien machen. In der Folge der deutlichen Sprache, die die o.g. Zahlen sprechen, wurde gefragt, was getan wird, um die „generationsübergreifende Weitergabe von Bildungs- und damit auch Lebenschancen in Deutschland als Normalfall“ (Middendorf 2008: 109) zu korrigieren.
Primäre und sekundäre Herkunftseffekte
In der Analyse von Bildungschancen wird von primären und sekundären Effekten der sozialen Herkunft gesprochen. Primäre Herkunftseffekte bezeichnen die Einflüsse des Elternhauses auf die Kompetenzentwicklung, sekundäre Effekte dessen Einflüsse auf die Bildungsentscheidungen (Boudon 1974). Die Erweiterung der Zugangsberechtigungen zum Hochschulstudium ist im Wesentlichen auf einen Ausgleich der sekundären Effekte gerichtet: Nicht nur der Besitz der allgemeinen Hochschulreife soll zum Hochschulzugang berechtigen, sondern auch andere Bildungswege wie Fachhochschul- oder fachgebundene Hochschulreife, berufliche Tätigkeiten auf bestimmten Niveaus oder Βerufsaus- und -fortbildungen. Daneben steigt die Diversität der Hochschultypen oder der als Hochschulen anerkannten Institutionen (z. B. jüngst die Berufsakademien über Baden-Württemberg hinaus).
Beispiel Universität Hamburg
Schauen wir uns das Beispiel Universität Hamburg an. Im Hamburger Hochschulgesetz stehen Novellierungen an, die zum Wintersemester 2010/11 greifen: so soll der schon lange bestehende Meisterparagraph (Beruflich Qualifizierte, die über eine abgeschlossene Berufsausbildung und eine dreijährige Berufspraxis verfügen, sind zum Studium in allen Studiengängen berechtigt, für die sie eine Eingangsprüfung bestanden haben) durch weitere Bestimmungen ergänzt werden, mit denen auch bestimmte Berufsfortbildungen fachungebunden anerkannt werden. In der Darstellung der Hamburger Behörde für Wissenschaft und Forschung klingt dies nach Durchbruch:
Ziel der Neuregelungen ist es, die Durchlässigkeit zwischen beruflicher und hochschulischer Bildung zu erhöhen. Beruflich Qualifizierte, die eine Aufstiegsfortbildung durchlaufen haben, erhalten danach künftig eine allgemeine Hochschulzugangsberechtigung und werden somit Abiturienten gleichgestellt. (Pressemitteilung der Behörde für Wissenschaft und Forschung der Freien und Hansestadt Hamburg vom 7.6.2010)
Ohne Zweifel ist dies eine prompte Reaktion auf die Neufassung der KMK-Ländergemeinsamen Strukturvorgaben vom Februar 2010 und geht mit der Fachungebundenheit sogar über sie hinaus. Vielleicht wirkt hier die Schließung der HWP (Hamburger Universität für Wirtschaft und Politik) als eigenständiger Hochschule des Zweiten Bildungsweges nach und das damalige Versprechen, diese Zugangsmöglichkeiten weiter vorzuhalten.
Aus anderen Universitäten tönt es da auch ganz anders. So hat die Universität Frankfurt den Zugang über einen Fachhochschulabschluss wieder abgeschafft, als sie Stiftungshochschule wurde. Und auch ohne Meister-§ werden an einer Technischen Universität die heterogenen Bildungsvoraussetzungen beklagt, deren Ausgleich die Ressourcen weit übersteigen und den Zeithaushalt des Bachelorstudiums durcheinander bringen würden. Vor einer Ausweitung der Zugangsberechtigungen wird hier im Interesse eines wissenschaftlichen Studiums gewarnt.
Faktoren unzureichender Durchlässigkeit
Wie dem auch sei, Durchlässigkeit von beruflicher und hochschulischer Bildung ist mit diversen Zugangsmöglichkeiten noch nicht erreicht, es ist höchstens eine notwendige, nicht aber die hinreichende Bedingung erfüllt. Grundlage dieser Behauptung ist die Kluft zwischen der Studienberechtigung und der Studienaufnahme:
Die Studierneigung bleibt stabil; etwa drei Viertel eines Studienberechtigtenjahrgangs nehmen ein Studium auf. Die Wahrscheinlichkeit, ein Studium zu beginnen, ist (auch bei gleichen Abiturnoten) deutlich größer, wenn zumindest ein Elternteil bereits ein Hochschulstudium abgeschlossen hat. An diesem grundlegenden Befund hat sich seit mehr als einem Jahrzehnt nichts Wesentliches verändert. (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2010: 9)
Wir müssen also fragen, wie wir mehr Studienberechtigte in die Hochschulen holen können, denn für ein Viertel ist ein Studium nicht so attraktiv, dass sie die Hochschule tatsächlich betreten. Hierfür liegt der Schlüssel offensichtlich nicht in der Zugangsberechtigung, sondern in der antizipierten mangelnden Passung.
Ein weiterer Tatbestand schränkt die Wirkung von vermehrten Zugangsberechtigungen ein: Die in der Vergangenheit geringe Nutzung bestehender Möglichkeiten, ein Studium ohne Abitur über eine Aufnahmeprüfung aufnehmen zu können. Lange Zeit blieb der Anteil dieser Studierenden unter 2% (vgl. Teichler/Wolter 2004: 65). All dies führt dazu, dass die tatsächliche Diversität der Studierenden, in der bildungspolitisch zuweilen die einzige Chance gesehen wird, die Studierenden- und auch die Absolventenquote merklich zu erhöhen, hinter den Erwartungen zurück bleibt.
Geschlechter-, Herkunfts- und Zugangssegregation entlang von Fächer- und Hochschulgrenzen
Zur Veranschaulichung wird hier auf aktuelle Daten aus einem laufenden Forschungsprojekt Bezug genommen: Im BMBF-Forschungsprojekt USuS – Untersuchung zu Studienverläufen und Studienerfolg – an der Universität Hamburg wird in einer mehrjährigen Panelstudie eruiert, worin die Barrieren, aber auch die positiven Faktoren für ein erfolgreiches Studium bestehen und wie diese durch hochschuldidaktische Interventionen beeinflusst werden können. In einer systematischen Kombination werden unterschiedliche Methoden (Dokumentenanalysen, quantitative Online-Befragungen, qualitative Interviews und hochschuldidaktische Interventionen) mit dem Ziel der Veränderung der Studienpraxis eingesetzt.
In den in USuS einbezogenen Studiengängen sehen wir eine Homogenität, die dem Bemühen um eine gemischte Studierendenpopulation zuwiderläuft, obgleich es an allen beteiligten Hochschulen eine ähnliche Zugangsregelung wie den Meister-§ gibt. Im Folgenden werden zur Veranschaulichung einige Zahlen aus dem USuS-Projekt wiedergegeben (Bülow-Schramm/Rebenstorf 2010):
Im USuS-Sample werden Studiengänge im Sozialen Bereich zu 80% von Frauen studiert, die Ingenieurwissenschaften umgekehrt zu über 80% von Männern, trotz Initiativen zum Wecken von Technikbegeisterung bei Mädchen und Frauen (vgl. mäta - Mädchen Talente Technik Foren in MINT des VDI/VDE.
Ein Migrationshintergrund ist bei höchstens 12 % der Studierenden in den männerdominierten technikaffinen Studiengängen gegeben, bei 5% im Lehrerberuf.
Fast ebenso deutlich wie im Hinblick auf Geschlecht und Migrationshintergrund ist die Segregation bezogen auf den Bildungshintergrund und den Hochschulzugang. Wir haben den Bildungshintergrund mit dem höchsten Bildungsabschluss des Vaters ermittelt und finden die niedrigsten Anteile von Studierenden mit akademischem Hintergrund in den Fachhochschul-Studiengängen Informatik und Soziale Arbeit, die höchsten an einer Technischen Universität (Ingenieurswesen). Dennoch ist auf diesem Feld viel Bewegung zu verzeichnen, hat doch mindestens ein Viertel der Studierenden über alle Studiengänge hinweg einen familiären Bildungshintergrund auf Hauptschulniveau.
Den Weg in die Hochschule finden die Studierenden je nach besuchtem Hochschultyp mit unterschiedlichen Zugangsberechtigungen alles in allem wieder homogener.
An die Universitäten (Ingenieurswesen, Lehramt) führt nach wie vor der Königsweg „Abitur“ (bis 98 % der Studierenden beschreiten ihn) und an der Fachhochschule sind die Studierenden mit fachgebundener oder Fachhochschulreife fast unter sich. Nur über die Aufnahmeprüfung kommt fast niemand – am meisten noch ins Lehrerstudium, wo die geforderte Praxisnähe der Lehrkräfte an beruflichen Schulen Sonderzulassungen nahelegt. Hamburgspezifisch könnte sich auch die Wirkung der Tradition des Studienzugangs über eine Aufnahmeprüfung andeuten.
Der antizipierte Studienerfolg als Motivator
Diese Segregation nach Zugangsberechtigung, akademischem Hintergrund, Migration und Geschlecht entlang von Hochschultypen und Studiengängen verweist darauf, dass die Selektionen vielfach vor dem Studium stattfinden, und dass nicht nur die formalen Zugangsmöglichkeiten über die Studienwahl bestimmen, sondern auch die Antizipationen von Dingen wie dem Zurechtkommen mit den Studienanforderungen, Fremd- oder Vertrautheit des Regelsystems Hochschule, Kosten des Studiums, Chance auf einen erfolgreichen Abschluss und den Berufsperspektiven („lohnt“ sich das Studium im Vergleich zur erreichten Berufsposition?).
Wie berechtigt solche Überlegungen sind, zeigen die Studienabbruchquoten: die Selektion setzt sich in der Hochschule fort. So brechen Studierende von Fachoberschulen und Fachgymnasien in einem deutlich höheren Maß ihr Studium ab, als es Studierende mit Abitur von Gymnasium oder Gesamtschule tun. (Heublein et al. 2009: 65) Als Grund für den Studienabbruch wird überdurchschnittlich oft ein Scheitern an den Leistungsanforderungen genannt, was die Studierenden auf Wissenslücken zurückführen. Unter den neuen Bedingungen bolognakonformer Studiengänge entfalten diese Lücken fatale Wirkung: bestand in den „alten“ Studiengängen noch die Möglichkeit bis zur Zwischenprüfung fehlendes Wissen auszugleichen, so muss dies in den Bachelorstudiengängen innerhalb des ersten Studienjahres erfolgen wegen der vielerorts exmatrikulationsrelevanten Prüfungen von Beginn an. So erschwert ein zentrales Merkmal des Bologna-Prozesses – die Einführung studienbegleitender Prüfungen – die Realisierung eines zentralen Ziels – die stärkere Öffnung der Hochschulen für nicht-traditionelle Studierende.
Diese Befunde sind jedoch keine unabänderlichen Tatsachen, sondern es gilt die Studiengestaltung so zu reformieren, dass sich die Studienerfolgsaussichten auch für Studierende, die nicht über den Königsweg Abitur an die Hochschule kommen, erhöhen. Über kurz oder lang sollte darüber auch der antizipierte Studienerfolg steigen und damit die Motivation, überhaupt an die Hochschule zu gehen.
Die Studiengestaltung als Hebel zur faktischen Öffnung
Zur notwendigen Bedingung einer Öffnung der Hochschulen durch erweiterte Zugangsberechtigungen muss die hinreichende Bedingung einer den mitgebrachten Kompetenzen entsprechenden Studiengestaltung hinzukommen, also dem primären Herkunftseffekt Rechnung getragen werden. Im Forschungsprojekt USuS werden derartige Ansätze erprobt, über hochschuldidaktische Interventionsmaßnahmen. Auf Grundlage der Informationen, die durch den Einsatz unterschiedlicher Methoden gewonnen wurden, sind passgenaue Konzepte für die verschiedenen einbezogenen Studiengänge und deren spezifische Studierendenschaft entwickelt worden (vgl. Rebenstorf 2010).
- Kompetenzorientierte, adressatenbezogene Lehre mit erhöhter Transparenz als Reaktion auf die Klage über mangelnde Standardisierung und Transparenz bei Leistungsanforderungen und –bewertung: Betroffen sind hiervon ausgerechnet Studierende mit Berufserfahrung in Studiengängen, die diverse Berufserfahrung als Voraussetzung für die Immatrikulation vorschreiben. Der Ansatz des „Constructive Alignment“ (Biggs 2003) bietet Handreichungen für eine klare Definition der Lernziele in Verbindung mit der Bereitstellung einer entsprechenden Lernumgebung sowie regelmäßiger angemessener Formen der Überprüfung und Bewertung bereits vorhandener und erworbener Kompetenzen. Er schafft damit auf Seiten der Lehrenden ein Bewusstsein für die Diversität der Studierenden, für die Studierenden werden durch die klare Formulierung der lehrveranstaltungsspezifischen Lernziele sowie der damit in Einklang stehenden Prüfungsverfahren Leistungs- und Prüfungsanforderungen nachvollziehbar.
- Anerkennung des beruflichen Vorwissens im Studium: Studierende verfügen häufig über Vorwissen aus beruflicher Tätigkeit, Praktika oder aus Fachschulen, das in zu geringem Maße Berücksichtigung findet. In der Regel gilt, dass alle mit identischen Lernmaterialien und Prüfungsaufgaben konfrontiert werden, obwohl die Erfahrungen ausgesprochen divers sind. Das wird von Lehrenden oft als mangelndes Vorwissen beklagt statt als spezifische Stärke geschätzt. Die Studierenden sind aufgrund undifferenzierter Aufgabenstellung entsprechend Art und Umfang ihres Vorwissens leicht unter- oder überfordert. In einem USuS-Studiengang wird dieser Tatsache nun begegnet durch tutorielle Unterstützung „on demand“: Tutorien werden nicht allein danach eingerichtet, ob Lehrende meinen, dies sei für die Begleitung ihrer Lehrveranstaltung nötig, sondern die Studierenden können sich direkt an TutorInnen wenden, die sie beim Ausgleich spezifischer Wissenslücken unterstützen. In einem anderen Studiengang werden die Möglichkeiten des e-Portfolios bei der Anregung studentischer Reflektionstätigkeit (Merkt 2007) eingesetzt, um so Vorwissen und berufliche Erfahrung für den Kontext des Studiums zu aktivieren.
- Hohen Durchfallquoten vorbeugen: In den naturwissenschaftlich-technischen Fächern, insbesondere an Universitäten, sind hohe Durchfallquoten und damit auch Studienabbruchsquoten besonders alarmierend, die abschreckend auf die Studienentscheidung wirken. Im Studiengang Ingenieurwesen wurde darauf reagiert, indem eine klassische Vorlesung über individuelles Lehrkraft-Coaching um interaktive Elemente (minute papers etc.) angereichert wurde.
Stützende Strukturen
Weiterhin ist erforderlich, die Studienbedingungen für nicht-traditionelle Studierende so zu gestalten, dass sie verstärkt partizipieren, d.h. es sind auch strukturelle Maßnahmen erforderlich, die über die Lehrgestaltung in engerem Sinne hinausgehen.
Aus der Sozialerhebung des Studierendenwerkes ist bekannt, dass bereits heute rund zwei Drittel der Studierenden neben dem Studium erwerbstätig sind, von diesen ein knappes Drittel mit 17 Std./Woche und mehr. (Isserstedt et al. 2007: 24). Nicht-traditionelle Studierende, die in der Regel älter und berufserfahren sind, Familie und einen höheren Lebensstandard haben als traditionelle Studierende (z.B. eigene Wohnung), verlangen verstärkt nach berufsbegleitendem Studium. Hierfür gibt es verschiedene Modelle. Ein Beispiel sind duale Studiengänge, die nicht nur ausbildungsintegriert, sondern auch berufsbegleitend möglich sind.
Auch herkömmliche Studiengänge lassen Gestaltungsspielraum. Teilzeitstudiengänge würden die eleganteste Lösung bieten, Studium und Berufstätigkeit miteinander zu verbinden, sie machten im Jahr 2006 aber gerade einmal zwei Prozent aller Studiengänge aus. (Hennings 2006) In der Lehr- und Studiengestaltung kann das Element des blended-learning, also einer Kombination von Präsenz- und E-Learning, Freiräume und zeitliche Autonomie ermöglichen, die für eine studienbegleitende Erwerbstätigkeit erforderlich sind. Dies würde jedoch verlangen, die Anwesenheitspflichten endgültig aus den Studien- und Rahmenordnungen zu streichen.
Fazit
Strukturelle und hochschuldidaktische Veränderungen, auf die primären wie die sekundären Herkunftseffekte abzielende Maßnahmen sind notwendig, um die Selektivität einzudämmen, die Wissenschaftlichkeit des Studiums aber darüber nicht zu vernachlässigen. Erst dann könnten sich die deutschen Hochschulen an internationalem Standard messen: „So gibt es Länder, die eine Studienbeteiligung der Gruppe der nicht-traditionellen Studierenden von bis zu 15% aufweisen. Zu dieser Gruppe gehören die USA und Kanada.“ (Banscherus 2007: 46). Die Hamburger SPD strebt nach Aussage ihres Landesvorsitzenden Scholz immerhin schon einen Anteil von 10% an.
Literatur
- Autorengruppe Bildungsberichterstattung (Hg.) (2010): Bildung in Deutschland 2010. Bielefeld.
- Banscherus, Ulf (2007): Hochschulzugang für nicht-traditionelle Studierende, in: BdWi Studienheft 4.
- Biggs, John, (2003): Aligning Teaching and Assessing to Course Objectives. Teaching and Learning in Higher Education. Aveiro.
- Boudon, Raymond (1974): Education, Opportunity and Social Inequality. New York.
- Bülow-Schramm, Magret (2010): Wohin des Wegs, Bachelorstudierende? Hamburg.
- Bülow-Schramm, Margret/Rebenstorf, Hilke (2010): Studiengang, Studienerfahrungen und Folgerungen für die Hochschuldidaktik, Fachtagung des Hochschulpolitischen Arbeitskreises im DGB-Bezirk Niedersachsen u.a.
- Bülow-Schramm, Margret/Rebenstorf, Hilke/Wölk, Monique (2009): Zentrale Forschungsfragen und Analysemodell. Hamburg.
- Hennings, Mareike (2006):Indikator im Blickpunkt – Das Teilzeitstudium. Gütersloh.
- Heublein, Ulrich et al. (2009): Ursachen des Studienabbruchs in Bachelor- und in herkömmlichen Studiengängen. Hannover.
- Isserstedt, Wolfgang et al. (2007): Die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden in der Bundesrepublik Deutschland 2006. 18. Sozialerhebung des DSW, BMBF.
- Merkt, Marianne(2007): ePortfolios – der ‚rote Faden’ in Bachelor- und Masterstudiengängen, in: Marianne Merkt et al. (Hg.): Studieren neu erfinden – Hochschule neu denken. Münster.
- Middendorf, Elke (2008): Sozialgruppenspezifische Studienbeteiligung und Zusammensetzung Studierender, in: Adams, Andrea/Keller, Andreas (Hg.): Vom Studentenberg zum Schuldenberg? GEW-Materialien aus Hochschule und Forschung 113. Bielefeld.
- Rebenstorf, Hilke (2010): Hochschuldidaktische Interventionsmaßnahmen in USuS. Hamburg.
- Teichler, Ulrich/Wolter, Andrä (2004): Zugangswege und Studienangebote für nicht-traditionelle Studierende, die hochschule 2, 2004.
- Tessaring, Manfred/Wannan, Jennifer (2004): Berufsausbildung – Der Schlüssel zur Zukunft. Synthesebericht des Cedefop zur Maastrichtstudie. Luxemburg.
Februar 2011
Margret Bülow-Schramm ist Professorin i.R. am Zentrum f. Hochschul- und Weiterbildung der Universität Hamburg und Leiterin des Forschungsprojekts USuS - Untersuchung v. Studienverläufen und -erfolg. Hilke Rebenstorf ist seit 2009 dort wiss. Mitarbeiterin.