Wohnungen bauen, Pakete ausfahren, Schweine zerlegen – viele Arbeiten, für die sich in Deutschland nicht genügend Einheimische finden, werden von Migrant*innen übernommen. Sie sind oft unter prekären Bedingungen beschäftigt. In seinem Buch „Ganz unten im System“ gibt der Autor Sascha Lübbe Einblicke in den Arbeits- und Lebensalltag dieser Menschen und analysiert das System, das hinter ihrer Ausbeutung steht.
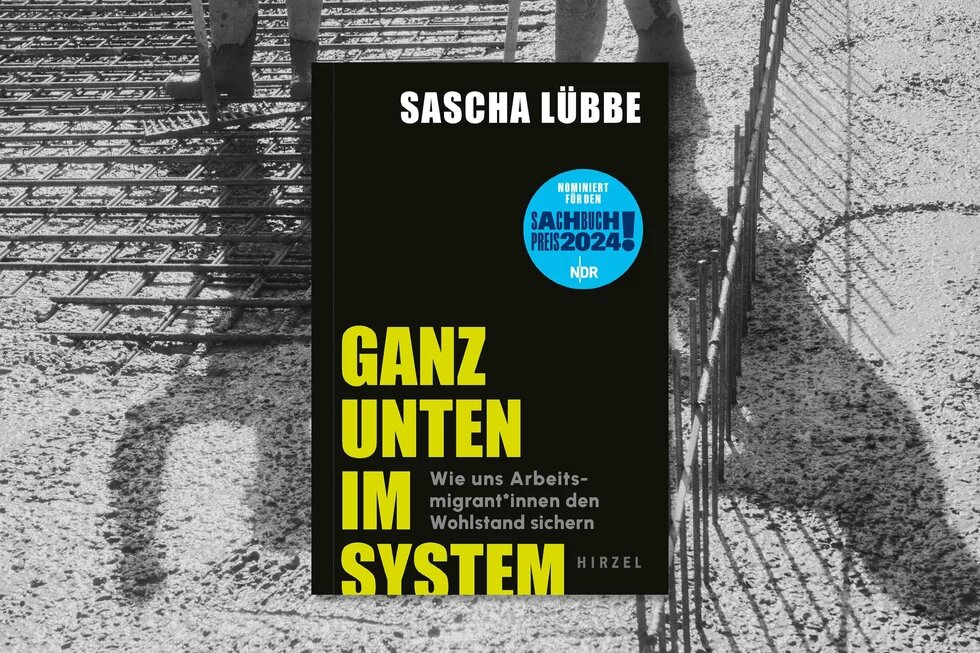
Es ist eng in dem Zimmer in dem Arbeiterwohnheim in Frankfurts Westen. Drei einfache Betten stehen da, drei Schränke, ein Tisch. Auf dem Kühlschrank läuft der Fernseher, ein rumänischer Sender ist eingestellt.
„Feierabend“, sagt Fabiu*, einer der drei Männer im Zimmer, fingert eine Bierdose aus einer Plastiktüte. Es ist Samstagnachmittag. Fabiu kommt gerade von der Arbeit.
Fabiu ist 47 Jahre alt. Ein robuster Typ: kräftig gebaut, kratzige Stimme, wacher Blick. Seit fast zehn Jahren arbeitet er als Maurer auf deutschen Baustellen. Er hatte Chefs, die ihn bei der Krankenkasse abgemeldet haben, ihn auf den offenen Beitragsrechnungen sitzen ließen. Chefs, die ihm kein Urlaubs- und kein Krankengeld zahlten. Immer wurde er schwarz bezahlt, immer arbeitete er länger als gesetzlich erlaubt. Mehrmals hat er die Firma deshalb gewechselt, inzwischen über 20 Mal. Geändert, sagt Fabiu, habe sich nichts.
Die Unsichtbaren
Fabiu ist einer von 70 ausländischen Arbeiter*innen, mit denen ich für mein Buch spreche. Über ein Jahr lang besuche ich Arbeiter*innen-Unterkünfte, rede mit Menschen, die auf Baustellen und Spargelfeldern arbeiten, in Schlachthöfen, in Lagern großer Logistikunternehmen. Ich treffe auf rumänische Bauarbeiter, die zu siebt in einer heruntergekommenen Zwei-Zimmer-Wohnung leben, dafür pro Person 350 Euro Miete zahlen. Auf usbekische Lkw-Fahrer, die über Monate nicht zu Hause waren, ihre Kinder nur auf Handybildschirmen aufwachsen sehen.
Sie sind die „Unsichtbaren“; Männer und Frauen, die nachts die Büros wischen, auf abgelegenen Feldern Spargel ernten, im Kühlhaus Schweine zerlegen. Man sieht sie immer nur kurz; etwa, wenn sie Pakete ausliefern. Eigentlich weiß man nichts über sie.
Dabei reden wir von einer großen Gruppe von Menschen. Über eine Million vollzeitbeschäftigte Ausländer*innen arbeiten im deutschen Niedriglohnsektor, ihr Anteil in diesem Segment beträgt 30 Prozent. Sie übernehmen Arbeiten, für die sich in Deutschland kaum noch jemand findet: Reinigung, Gastronomie, Bauwesen – ohne Migrant*innen würden Teile der deutschen Wirtschaft kollabieren.
Wer mit ihnen spricht, hört Geschichten von gesellschaftlichen Umbrüchen in der Heimat, von großer Ausweglosigkeit. Aber auch Geschichten von ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in Deutschland, von vorenthaltenen Löhnen, aggressiven Chefs. Es gibt wiederkehrende Muster dabei. Hinter ihrer Ausbeutung steht ein System.
Die Wende von 1989 als Einschnitt
Fabiu kommt, wie ein Großteil der ausländischen Arbeiter*innen auf deutschen Baustellen, aus Osteuropa. Aus Rumänien, dem Nordosten des Landes, einer besonders armen Region. Die Wende von 1989, sagt er, war für seine Familie ein gewaltiger Einschnitt. Vater und Mutter verloren ihre Jobs, mussten sich neu orientieren. Er selbst musste mitansehen, wie immer mehr Freund*innen das Land verließen; nach Israel gingen, in die Türkei, nach Italien und Spanien. 2013, die Finanzkrise hatte Rumänien erheblich geschwächt, sah auch Fabiu keine Zukunft mehr im Land und kam nach Deutschland.
Sein Alltag seitdem: Fünf Uhr aufstehen, arbeiten, abends einkaufen, Brötchen für den nächsten Tag schmieren. Halb zehn ins Bett. In seiner Heimat, sagt er, habe er gern Billard gespielt. Hier fehle ihm dafür die Kraft.
Fragt man Fabiu, warum er sich das antut, antwortet er dasselbe, was die meisten Migrant*innen sagen, denen man diese Frage stellt: Damit die Kinder es einmal besser haben. Rund 1.500 Euro verdient Fabiu hier mehr als in Rumänien. Mit dem Geld unterstützt er seine Frau, die zu Hause geblieben ist, später sollen seine zwei Kinder davon studieren.
Fabiu ist einer der Männer, die sich irgendwie mit der Situation arrangiert haben, über die Runden kommen. Bei meinen Recherchen treffe ich auch auf Menschen, denen das nicht gelingt.
Das Recht des Stärkeren
Zum Beispiel Adrian*. Auch er lebt in Frankfurt, eine Zeitlang im selben Heim wie Fabiu. Doch dann gab es Ärger mit dem Hausmeister, der schmiss ihn raus. Seitdem lebt Adrian in einer Notunterkunft.
Adrian ist 49, ein Mann mit gebeugten Schultern, wässrig-grünen Augen und dünner Stimme. In Rumänien hat er Ingenieurwesen studiert, in Deutschland arbeitet er auf dem Bau. Er hat ein schweres Alkoholproblem, kann sich nicht durchsetzen. Sein letzter Chef nutzte das aus.
Über Monate bekam Adrian nur einen Teil der geleisteten Stunden ausgezahlt. Während Männer wie Fabiu stark genug sind, sich in diesen Fällen zu wehren oder zumindest zu gehen, blieb Adrian lange still. „Ich bin ja fremd in diesem Land“, sagt er. Für die letzten Wochen sah er gar keinen Lohn.
Die Ausbeutung hat System
Um zu verstehen, wie so etwas sein kann, in einem Land wie Deutschland, muss man sich das System dahinter ansehen. Es gleicht einer Pyramide. Mit großen Firmen an der Spitze, die Arbeiten nicht selbst ausführen, sondern sie – abzüglich einer Provision – an andere Firmen auslagern, die Subunternehmen. Den großen Firmen erlaubt das, sich ein stückweit der Verantwortung zu entziehen. Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz, Nichtzahlung von Kranken- und Urlaubsgeld – all das geht auf das Konto der Subunternehmen.
Die reichen die Arbeiten, abzüglich einer Provision, oftmals weiter an andere Subunternehmen. Subunternehmerketten entstehen dann. Sie sorgen dafür, dass am Fuß der Pyramide nur noch ein Teil des Geldes ankommt, bei den ausländischen Arbeiter*innen ganz unten im System.
Über die Jahre ist so eine regelrechte Schattenwelt entstanden. Ein Bereich der Arbeitswelt mit undurchsichtigen Firmenstrukturen, mit Briefkastenfirmen und Scheinrechnungen. Von Gewerkschaften kaum zu durchdringen, von Behörden schwer zu kontrollieren. Eine Welt, in der das Recht des Stärkeren gilt. Und Menschen wie Adrian auf der Strecke bleiben.
Verbesserungen in der Fleischindustrie
Es gibt eine Branche, in der ist man gezielt gegen die Auswüchse des Systems vorgegangen: die Fleischindustrie. Auch hier waren die Arbeitsbedingungen der ausländischen Arbeiter*innen extrem. Die Menschen, angestellt bei Subunternehmen, arbeiteten bis zu 16 Stunden am Tag, schliefen teilst zu sechst in einem Zimmer.
Seit Inkrafttreten des Arbeitsschutzkontrollgesetzes im Januar 2021 dürfen Unternehmen mit mehr als 49 Mitarbeiter*innen in ihrem Kerngeschäft Arbeiter*innen nicht mehr über Subunternehmen beschäftigen. Sie müssen sie selbst anstellen. Die Firmen sind zudem verpflichtet, die Arbeitszeiten digital zu erfassen, die Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften zu dokumentieren.
Eine Evaluation des Gesetzes kommt zu positiven Ergebnissen. Auch Beratungsstellen berichten, dass es kaum noch extreme Überstunden und eine starke Überbelegung der Zimmer gebe. Bei Problemen sei es jetzt einfacher, die Verantwortlichen zu erreichen – weil es die großen Firmen selbst sind, nicht mehr die Subunternehmen.
Das Gesetz gilt als Paradebeispiel im Kampf gegen Arbeitsausbeutung. Das ist gerechtfertigt, birgt aber auch eine Gefahr: Es könnte der Eindruck entstehen, man muss in der Branche jetzt nicht mehr genau hinsehen.
Mit falschen Versprechungen nach Deutschland gelockt
Ich treffe Eugen* an einem Sommertag in einer kleinen Stadt in Nordrhein-Westfalen, in einer Region, die einen unappetitlichen Namen trägt: Fettfleck. Nirgends in Deutschland werden mehr Tiere geschlachtet als hier.
Eugen ist 25, kräftig, aber nicht dick, schwarzer Rauschebart, die Arme voller Tattoos. Er und sein Cousin seien vor etwa einer Woche angekommen, erzählt er. Sie seien schockiert gewesen. Gesucht würden Arbeitskräfte in einer Salamifabrik, hieß es in der Online-Annonce, auf die sie in ihrer Heimat Rumänien geantwortet hatten. Acht Stunden Arbeit am Tag, untergebracht sei man in einem schönen möblierten Zimmer. Als sie hier aus dem Bus stiegen, hieß es stattdessen: Ihr arbeitet im Schlachthof. Ihr Zimmer war ein kleiner, karger Raum mit zwei Eisenliegen, einem Kühlschrank, einem Tisch. Und einem großen Wasserfleck an der Wand.
Es habe keine Einarbeitung gegeben, sagt Eugen, man habe sie einfach ans Fließband gestellt. Zehn Stunden würden sie arbeiten, statt der vereinbarten acht. Eugen berichtet von einem Vorarbeiter, der die Arbeiter*innen ständig anschreien würde. Es herrsche immenser Druck. Als er einmal mit Fieber zu Hause blieb, habe man umgehend gedroht, ihm zu kündigen. „Auf Dauer“, sagt Eugen, „ginge man hier kaputt.“
Die Subunternehmen sind immer noch aktiv
Mit Verabschiedung des Gesetzes wurde der Eindruck erweckt, die Subunternehmen seien nun ihrer Macht beraubt. Dem ist nicht so. Es stimmt zwar: Die Arbeiter*innen sind nicht mehr bei ihnen angestellt. Im Hintergrund sind die Firmen aber weiterhin aktiv. Rekrutieren die Arbeiter*innen im Ausland, kümmern sich in Deutschland um ihre Unterbringung. Auch die Vorarbeiter*innen, berüchtigt für ihren krassen Umgangston, waren vorher bei den Subunternehmen angestellt. Man hat sie einfach übernommen.
Das Gesetz hat zudem einen blinden Fleck. Es gilt für den Kernbereich der Branche: für das Schlachten, Zerlegen und Verarbeiten des Fleisches. Nicht aber für andere Arbeiten, die in einem Schlachthof anfallen. Das Reinigen der Geräte zum Beispiel. Die Menschen, die diese Arbeiten ausführen, sind weiterhin über Subunternehmen beschäftigt. Hier gibt es weiterhin viele Probleme, vor allem mit unbezahlten Überstunden.
Dass viele Migrant*innen sich nicht trauen, sich zu wehren, liegt an den extremen Abhängigkeitsverhältnissen, in denen sie gefangen sind. Oft hängt an der Arbeit auch die Unterkunft. Wer sich beschwert, riskiert, nicht nur den Job, sondern auch die Bleibe zu verlieren. Eine Heimkehr wiederum ist für die meisten keine Option.
Eine Situation der Ausweglosigkeit
Eugen stammt ebenfalls aus dem Norden Rumäniens; aus einfachen Verhältnissen, wie er sagt. Sein Vater schlage sich mit Gelegenheitsjobs durch, seine Mutter sei Reinigungskraft. Ein Semester lang habe er Agrarwissenschaften studiert. Doch die Familie konnte sich nur ein Kind an der Universität leisten. Also ließ Eugen seiner Schwester den Vortritt.
Der Job im Schlachthof ist nicht sein erster in Deutschland, letztes Jahr war er schon mal hier. Arbeitete als Fahrer für ein Versandhaus, angestellt bei Subunternehmen. Mal bekam er Überstunden nicht bezahlt, mal gar keinen Lohn. Dennoch kehrte er nach einem kurzen Aufenthalt in Rumänien nach Deutschland zurück. Weil er in der Heimat keine Perspektive sah; nicht für sich, nicht für seine Familie, er hat einen einjährigen Sohn.
Von Erntehelfer*innen zu Gastarbeiter*innen
Die Ausbeutung von Arbeitsmigrant*innen hat in Deutschland traurige Tradition. Eine Dissertation von 1914 schildert die Situation von Arbeiter*innen aus den polnischsprachigen Gebieten Russlands und Österreich-Ungarns. Sie halfen auf deutschen Feldern aus, weil es nicht genügend einheimische Bauern gab.1 Der Studienautor, Andreas Mytkowicz, schreibt von heruntergekommenen Unterkünften, in denen die Migrant*innen lebten. Von falschen Versprechungen, mit denen sie nach Deutschland gelockt wurden. Wie Eugen, nur 100 Jahre früher.
Zur Rolle der Politik schreibt Mytkowicz: „Der Gesetzgeber nimmt gegenüber den vom Auslande einwandernden Arbeitern eine Abwehrstellung ein, sucht das heimatliche Interesse zu schützen und die Einwanderung als einen nur zurzeit nötigen Ersatz der Arbeitskräfte zu dulden“. Er beschreibt damit eine Einstellung, die Jahrzehnte später im Begriff des „Gastarbeiters“ seinen euphemistischen Ausdruck findet: Migrant*innen sind erwünscht, wenn sie Arbeiten übernehmen, für die sich keine Einheimischen finden. Sind die Arbeiten erledigt, sollen sie möglichst wieder gehen.
Um keinen falschen Eindruck zu erwecken: Natürlich hat sich seit Mytkowicz’ Dissertation etwas getan, vor allem in den letzten Jahren. Die Einführung des gesetzlichen Mindestlohns 2015 etwa markierte einen entscheidenden Einschnitt. Waren ausländische Arbeiter*innen in Deutschland vorher teils für einen Stundenlohn von zwei Euro beschäftigt, kommt das jetzt nur noch in Einzelfällen vor. Aber es kommt vor. Etwa bei Menschen wie Adrian, die teils über Monate nur einen Teil ihres Lohnes ausbezahlt bekommen, über Wochen gar kein Geld sehen.
Das Problem ist die Abgeschiedenheit dieses Sektors der Arbeitswelt. Sie ist es die, die Ausbeutung ermöglicht. Dabei spielen auch mangelnde Kontrollen mit hinein. Die Initiative „Faire Landarbeit“ hat untersucht, wie häufig die Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls Betriebe in Branchen mit hohem Migrant*innenanteil kontrolliert. Meist waren es deutlich unter zehn Prozent, in der Landwirtschaft nur 1,1 Prozent aller Betriebe.
Die Angst der Betroffenen, Verstöße zu melden, und fehlender gesellschaftlicher Druck führen ebenfalls dazu, dass sich bestimmte Strukturen halten. Auch von der Wirtschaft war lange Zeit keine Besserung zu erwarten. Für die Firmen bedeuten bessere Arbeitsbedingungen Mehrausgaben. Viele schrecken davor zurück.
Allerdings ist die Fluktuation in migrantisch geprägten Branchen überdurchschnittlich hoch. Im Einstiegsbereich der Fleischbranche etwa bleiben die wenigsten ein Jahr. Solange genügend Arbeiter*innen nachkommen, mag das für die Firmen funktionieren. Die Frage ist, ob das so bleibt.
Sinkende Zahlen, steigender Bedarf
Die Zahl osteuropäischer Migrant*innen sinkt seit Jahren. Wer aus den Herkunftsländern migrieren konnte, ist meist schon weg. Zudem lassen demografischer Wandel und Arbeitskräftemangel in Ländern wie Polen die Löhne steigen. Das macht es für die Menschen dort unattraktiver, nach Deutschland zu gehen.
Hier aber wächst der Bedarf an Arbeitskräften. Die deutsche Wirtschaft ist auf eine jährliche Nettozuwanderung von 400.000 Menschen angewiesen, schreibt das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung. Da viele Migrant*innen das Land wieder verlassen, heißt das: Pro Jahr müssen über eine Million zuwandern. Auch die Geflüchteten-Zahlen können das nicht kompensieren.
Wenn den Firmen die Arbeiter*innen weglaufen, niemand mehr nachkommt, werden sie auf lange Sicht also zusehen müssen, wie sie sie halten. Das wird nur über bessere Arbeitsbedingungen gehen.
* Die Namen der Personen wurden zu ihrem Schutz geändert.
***
Ganz unten im System, Hirzel-Verlag, 208 Seiten, 22 Euro.
Fußnoten
- 1
Mytkowicz, Andreas: Ausländische Wanderarbeiter in der deutschen Landwirtschaft, Inaug.-Diss., Posen 1914.


